Genossenschaftsgedanke. Anstatt einer Neujahrsansprache veröffentlichen wir dieses Diskussionspapier der Arbeitsgruppe: Genossenschaft & Politik der igenos e.V. Es handelt sich um eine aktuelle Analyse und Bestandsaufnahme, die sich mit der Umsetzung “unserer Genossenschaftsidee” befasst. Das System Genossenschaft steht seit 2016 unter besonderem UNESCO Schutz. Das Genossenschaftswesen ist Weltkulturerbe und verdient besondere Beachtung. (C) igenos e.V. 2017
Lesezeit: ca. 20 Minuten; Schreibstil: anspruchsvoll; GenoLeaks Bezug: Operation Kürbis / GenoGate Affäre
- Genossenschaftsgedanke: Die Verfremdung des Systems “Genossenschaft” – Einführung in die Thematik.
Seit der Entstehung der ersten modernen Genossenschaften in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben sich die ökonomischen, technischen und gesellschaftlichen Umweltbedingungen tiefgreifend verändert. Folgerichtig können heutige Genossenschaften nicht vom selben Geist wie damals erfüllt und der genossenschaftliche „kulturelle Kern“ nicht unverändert verbindlich sein wie in der Entstehungsphase. Andererseits ist es eine Binsenweisheit, dass heutige Genossenschaften nachhaltige Vorteilspositionen im Wettbewerb nur aufbauen und erhalten können, wenn sie ein diffuses Selbstverständnis vermeiden, indem sie sich durch ein unverwechselbares Profil von ihren Konkurrenten abheben. Als herausragend wichtige Differenzierungspotenziale sind arteigene Besonderheiten[1], in denen sich genossenschaftliche Identität manifestiert.
Eine zeitgemäße Modifikation zentraler Werte einer Genossenschaftsidentität kann und darf nicht beliebig und insbesondere nicht durch bloße Annäherung an Strategien der Konkurrenten geschehen. Erfolgreiche Behauptung im Markt und die Erfüllung des mitgliederbezogenen Auftrags verlangt nach Strategien, die darauf hinwirken, das Genossenschaftssystem als Ganzes funktionsfähig zu erhalten.[2] Dies erfordert, typische Stärken des Genossenschaftsmodells auszubauen, um eine möglichst klare Abgrenzung von anderen Unternehmensformen zu erreichen. Genossenschaften brauchen Orientierungen, die ihnen zu einem unverwechselbaren Erscheinungsbild verhelfen und das Fundament für eine Genossenschaftsidentität bilden, von der positive Einflüsse sowohl auf eine aktive Mitgliederorientierung als auch auf eine entsprechende Zuwendung der Mitglieder zur Genossenschaft ausgehen. Dazu wäre es notwendig, die wesentlichen genossenschaftlichen Charakteristika bewusst als Wettbewerbsvorteil herauszustellen und zur offensiven Profilierung im Wettbewerb zu nutzen. Dies erscheint umso naheliegender, je härter der jeweils relevante Markt umkämpft ist und ja stärker Genossenschaften in das Konkurrenzgeschehen eingebettet sind.
Mit der Verhaltensempfehlung, sich auf dem Markt zu behaupten ohne die Identität ihrer Rechtsform aufzugeben, stimmen die heutigen Gegebenheiten nur in Ausnahmefällen überein. Das ist kein Geheimnis. In den letzten Jahrzehnten haben sich besonders auf der primärgenossenschaftlichen Ebene des deutschen Genossenschaftssektors fragwürdige Veränderungen vollzogen, die ein Hinterfragen verdienen. Sie betreffen die Kompetenzverteilung zwischen den Organen einer Genossenschaft, das Größenwachstum und die Ausdehnung des Nichtmitgliedergeschäfts mit negativen Auswirkungen auf die Bedeutung der Mitgliedschaft und den Mitgliederstatus. Nicht zu übersehen sind ferner die modifizierte Anwendung bestimmter genossenschaftlicher Prinzipien sowie der in einzelnen Sparten zu beobachtende Wandel der Mitgliederbeziehungen zu reinen Kundenbeziehungen. Nicht zuletzt wird es dort, wo arteigene und darunter ökonomisch nützliche Konturen verwischen, schwerfallen, Vorteile zu identifizieren, die Außenstehende zum Erwerb der Mitgliedschaft veranlassen könnten.
Die eingetretenen, im genossenschaftsbezogenen Schrifttum seit den 1980er Jahren eingehend erörterten Identitätseinbußen sind als Verfremdungen des Systems „Genossenschaft“ zu bezeichnen. Dieses Thema verrät Unbehagen. Aber gerade erscheint es gerechtfertigt, die hier zunächst nur angedeuteten Veränderungen sowie ihre Ursachen vor dem Hintergrund der rechtlichen Verfassung der Genossenschaft und Vorstellungen von einer „artgerechten Genossenschaft“ zu diskutieren. Aus der Identifikation von Fehlentwicklungen können sich Anregungen für die Herausbildung von Erfolgspotenzialen ergeben
- Was ist eine Genossenschaft?
Die Antwort auf diese Ausgangsfrage hat sich an die Merkmale, die eine Genossenschaft nach Maßgabe des geltenden deutschen Genossenschaftsgesetzes aufzuweisen hat, zu halten. Die „eingetragene Genossenschaft“ stellt eine eigenständige Rechts-, Unternehmens- und Kooperationsform dar. Gemäß § 1 Abs. 1 des geltenden deutschen GenG sind Genossenschaften „Gesellschaften von nicht geschlossener Mitgliederzahl, deren Zweck darauf gerichtet ist, den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern“.
Die in dieser Definition enthaltenen Merkmale beschreiben sowohl die originelle Rechtsform eG als auch das unverwechselbare Wesen einer Genossenschaft, nämlich
- einen freiwilligen Zusammenschluss von privaten Haushalten oder Erwerbsunternehmen, die das gemeinsame Interesse an der Lösung ökonomischer oder/und nichtökonomischer Aufgaben durch Zusammenarbeit verbindet (Gesellschaft).
- An der Mitgliedschaft Interessierte treten freiwillig in die Genossenschaft ein und können ebenso wieder austreten. Insofern ist der Mitgliederkreis offen, was zu einem variablen Mitgliederbestand führt (nicht geschlossene Mitgliederzahl)
- Bei der Genossenschaft handelt es sich um eine zweckgebundene Gesellschaftsform, was auf keine andere Rechtsform zutrifft.[3] Die Geschäftstätigkeit ist zwingend darauf zu richten, die Mitglieder – und nur diese – bei der Erreichung ihrer wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Ziele zu unterstützen. (Gebot der Mitgliederförderung)
- Die Bereitstellung von Leistungen, die sich zur Förderung der Mitgliederbelange eignen, ist einem Gemeinschaftsunternehmen übertragen, das die Verbindung zu den relevanten Märkten herstellt und Fördergeschäftsbeziehungen zu den Mitgliedern unterhält (gemeinschaftlicher Geschäftsbetrieb).
Es sind dies den Genossenschaften immanente unternehmensgestalterische Besonderheiten, die keine andere Rechtsform aufweist. Die eG ist der einzige Unternehmenstyp, der von Mitgliedern (als Eigentümern und Nutzern) getragen wird und ohne diese nicht vorstellbar. Aus dem obigen Bedingungsrahmen geht unverkennbar die vom Gesetzgeber gewollte Mitgliederzentrierung einer Genossenschaft hervor, weshalb unter den gesetzlichen Merkmalen der Auftrag zur Mitgliederförderung hervorzuheben ist. Die genossenschaftliche Idee besteht darin, privaten Haushalten oder Erwerbswirtschaften unter Wahrung ihrer Selbständigkeit und Verantwortlichkeit kooperative Möglichkeiten der Teilnahme am Wirtschaftsleben zu erschließen und zu sichern.
Kernstück genossenschaftlicher Betätigung ist das Zusammenwirken der Mitglieder zur Erhaltung oder Verbesserung der individuellen Lebensverhältnisse und Leistungsfähigkeit. Der Kooperationsgrundsatz betont, dass gemeinsame Ziele verfolgt und zusammen mit anderen Wirtschaftssubjekten erreicht werden soll, was Einzelne auf sich allein gestellt nicht zu leisten vermögen. Genossenschaften sind als Leistungs- und Fördergemeinschaften zum Nutzen der Mitglieder gedacht.
- Genossenschaftsgedanke: Was macht eine artgerechte Genossenschaft aus?
Bevor Verfremdungen des Systems „Genossenschaft“ zur Sprache kommen lässt sich bezogen auf sechs Untersuchungsbereiche zumindest umrissartig aufzeigen, wie eine Genossenschaft nach Maßgabe der Genossenschaftsidee und des geltenden Genossenschaftsrechts wahrnehmbar sein könnte. Die Ausgangsfrage lautet: Welche Elemente eines Zustandsbildes könnte und sollte eine artgerechte („echte“) Genossenschaft aufweisen?
- Erwartungen an das Managementhandeln
- Der einem genossenschaftlichen Vorstand von der Mitgliedergesamtheit erteilte Förderauftrag ist auf die jeweilige Bedürfnislage der Mitglieder hin zu konkretisieren.
- Markterfolg und betriebswirtschaftliche Effizienz stehen in einer Mittel-Zweck-Relation zur Erfüllung des gesetzlich vorgegebenen Förderzwecks (Fördererfolg).
- Im Spannungsfeld zwischen Tradition und Fortschritt wird erkennbar Wert auf die Erhaltung der unverwechselbaren Eigenart einer Genossenschaft gelegt.
- Mitgliedschaft und Mitgliederrollen
- Der Mitgliedschaft wird als exklusives Merkmal einer Genossenschaft verstanden und ihr ein hoher Bedeutungsrang zuerkannt.
- In der Genossenschaft nehmen die Mitglieder mit seiner Dreifachrolle als Träger, Nutzer der gemeinschaftlichen Einrichtungen und Kapitalgeber eine herausgehobene Position ein.
- Ohne Mitglieder ist eine Genossenschaft weder lebens- noch funktionsfähig, weshalb die Person des Mitglieds im Mittelpunkt des genossenschaftlichen Wirtschaftens steht.
- Grundsätzliche Ausrichtung der Genossenschaft und ihrer Geschäftspolitik
- Die Genossenschaft ist mitglieder- und demokratieorientiert, kooperationsorientiert und lokal- oder regionalorientiert.
- Die Bedürfnisse der Mitgliederkunden bestimmen die mitgliederorientierte genossenschaftliche Geschäftspolitik.
- Als Primärzielgruppe „ihres“ Unternehmens erfahren die Mitgliederkunden eine Vorzugsbehandlung gegenüber externen Kunden (Förderdifferenzierungsstrategie).
- Beziehung „Mitglieder – Genossenschaft“
- Bereitschaft der Mitglieder zur aktiven Mitwirkung an der demokratischen Selbstverwaltung der Genossenschaft, Wir-Bewusstsein, Systemvertrauen sowie Identifikation mit der Organisation sind ausgeprägt.
- In intensiven Leistungsbeziehungen kommt Loyalität gegenüber dem Gemeinschaftsunternehmen („Genossenschaftstreue“) zum Ausdruck.
- Gegenläufig zur Genossenschaftsorientierung der Mitglieder befleißigt sich die Genossenschaftsleitung einer nachhaltigen Mitgliederorientierung
- Gestaltung der Organisationsstruktur und Entscheidungsfindung
- Durch Festlegung zustimmungspflichtiger Geschäfte ist eine gewisse Begrenzung der Eigenverantwortlichkeit des Vorstands gewährleistet.
- Die Genossenschaftsleitung fördert der Einbindung qualifizierter Mitglieder in die Selbstverwaltung durch Motivation zur Übernahme eines Ehrenamtes im Aufsichtsrat oder in einem fakultativen Organ (Beirat, Arbeitsgruppe oder Projektteam).
- Eine gewisse freiwillige Selbstbeschränkung der Leitungsebene ermöglicht eine stärkere mitgliedschaftliche Einflussnahme der Mitgliederseite auf Willensbildung und Kontrolle.
- Ausrichtung der Akquisitionspolitik
- Mitgliederwerbung hat Vorrang vor einer Erweiterung des Kundenkreises durch Neukunden-Gewinnung.
- Ein lediglich „ergänzendes“ Nichtmitgliedergeschäft dient zur Mitgliedergewinnung, Kapazitätsauslastung, Stärkung der Stellung am Markt sowie der Förderkraft. .
- Die Mitgliedschaft muss keine Offerte an jedermann sein. Die Genossenschaft wird den Beitritt vorrangig den mit ihr intensiv kooperierenden Nur-Kunden anbieten.
Zweifellos ließe sich diese Übersicht ergänzen. Als angedachtes „Leitbild einer artgerechten Genossenschaft“ dürfte sie jedoch genügend Anhaltspunkte für die Bestimmung von Abweichungen vom arttypischen Profil einer Genossenschaft liefern. Im Folgenden wird untersucht, inwieweit eine Diskrepanz zwischen artgerechtem und realem Zustand besteht, die Anlass zu Besorgnis gibt. Eine Berechtigung hierzu ist darin zu sehen, dass die Genossenschaftswissenschaft, die sich noch vor 10 bis 15 Jahren in der Rolle eines Mahners intensiv mit dieser Thematik befasste, diese Funktion jedoch seither aus nicht bekannten Gründen kaum noch wahrnimmt.
- Ursachen von Verfremdungen im Genossenschaftssektor
Ein solches Modell ist keineswegs überholt, weshalb davon merklich abweichende Genossenschaften zur Abkehr vom Status einer „echten Genossenschaft“ und zugleich zur Annäherung an den Gegensatztyp einer deformierten Genossenschaft beitragen. Es kommt zur Degeneration von Genossenschaftskultur. Je mehr Abweichungen bei einer Genossenschaft in Erscheinung treten und zu Identitätsdefiziten führen, umso mehr kann diese als von ihrer Art und von der Mitgliederbasis entfremdet bezeichnet werden. Und je mehr Einzelgebilde eines genossenschaftlichen Zweiges deutliche Verfremdungen aufweisen, desto mehr erscheint es angebracht, in der betreffenden Sparte ein „verfremdetes genossenschaftliches System“ zu sehen. Diesbezüglich unterscheiden sich die in der Statistik der deutschen Genossenschaften unterschiedenen fünf Genossenschaftszweige (Kredit-, ländliche, gewerbliche, Konsum- und Wohnungsgenossenschaften) voneinander. Wie aus dem umfangreichen genossenschaftsbezogenen Schrifttum hervorgeht, sind Verfremdungen besonders im Bereich größerer Primärgenossenschaften zu beobachten. Dafür lassen sich konkrete Belege liefern.
Fragen wir vorab nach den möglichen Gründen, die eine Verfremdung nicht weniger Genossenschaften herbeigeführt haben, so zeigt sich folgendes Bild:
- Nicht oder nur begrenzt beeinflussbare Veränderungen des Systems „Genossenschaft“ gehen auf den Wandel im wettbewerblichen und gesellschaftlichen Umfeld mit negativen Konsequenzen für die Mitgliederbindung an ihre Genossenschaft zurück. So lässt der Trend zur Ökonomisierung, zu Größenwachstum und Fusion die Vorzüge der Genossenschaft als wertebezogene Mitgliedergemeinschaft in den Hintergrund treten.[4] Davon betroffen sind sowohl die Organisationsbeziehung (Mitwirkung an der Selbstverwaltung, Teilhabe an Meinungsbildung und Erfahrungsaustausch im Mitgliederkreis u. a.) als auch die Wirtschaftsbeziehung (Frequentierung des gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs, Bereitstellung von Kapital u. a.) der Mitglieder zu ihrer Genossenschaft.
- Sodann hat der Gesetzgeber durch Änderungen des Genossenschaftsrechts mit Verfremdungspotenzial zum Verlust genossenschaftlicher Arteigenheit beigetragen. Zu erinnern ist an die Zulassung eines faktisch unbegrenzten Nichtmitgliedergeschäfts, die Rückbildung des Grundsatzes der genossenschaftlichen Selbstverantwortung durch Abmilderung der Mitgliederhaftpflicht, die Eigenverantwortlichkeit des Vorstandes oder die Möglichkeit einer Aufnahme investierender Mitglieder. Offenbar hat der Gesetzgeber zu wenig die Negativwirkungen bestimmter Gesetzesänderungen bedacht. Vor allem wurde versäumt, die eG in ihrer personalistischen Struktur und Förderwirtschaftlichkeit wieder eindeutig als mitgliedergewidmete Unternehmensform zu positionieren.[5]
- Auch die Genossenschaften selbst haben durch Vernachlässigung ihrer wertegebundenen Besonderheiten und Angleichung an die Geschäftsmethoden erwerbswirtschaftlicher Konkurrenten zur Verfremdung beigetragen. Weite Kreise der Genossenschaftspraxis interpretieren die Anpassungsstrategie als notwendige Reaktion auf die Marktverhältnisse. Für möglich erachtet wird eine „Orientierung an Wettbewerbszielen, an Marktanteilen und der Erringung wirtschaftlicher Macht häufig nur über eine gezielte Ausweitung des Nichtmitgliedergeschäfts und eine systematische Abkopplung von den Mitgliedern und deren Interessen möglich.“[6] Daraus folgt eine verminderte Bedeutung der Mitglieder und eine systematische Abkopplung von deren Interessen. Vor allem in größeren Genossenschaften sind die Werte des eG-Unternehmenstyps weitgehend in Vergessenheit geraten. Die Mitgliederbeziehung wandelt sich immer mehr zu einer bloßen Kundenbeziehung.
- Schließlich sind auch Mitglieder mit ihrem abnehmenden Genossenschaftsbewusstsein und passiven Verhalten gegenüber ihrer Genossenschaft an deren Verfremdung beteiligt.[7] Zu denken ist dabei an die „Formalmitgliedschaften“ nichtnutzender Mitglieder, deren Interesse sich auf eine möglichst hohe Rendite auf das eingebrachtes Kapital beschränkt. Dieser Personenkreis zeigt demgemäß kaum Bereitschaft, an der genossenschaftlichen Selbstverwaltung (Teilnahme an demokratischer Willensbildung und Kontrolle in der Mitgliederversammlung, Übernahme eines Ehrenamtes) mitzuwirken.
In Teilen der Genossenschaftspraxis läuft das genossenschaftliche Selbstverständnis Gefahr, derart verschwommen zu erscheinen, dass von einer Identitätskrise gesprochen werden kann.[8] Zum Nachweis dessen und besseren Verständnis werden im Folgenden ausgewählte Beispiele für Verfremdungserscheinungen bei Genossenschaften aufgezeigt, die aufgrund der Verwässerung ihrer typspezifischen Eigenart als Profileinbußen zu deuten sind. Anlass dazu besteht insbesondere, wenn die Wahrnehmung der Mitglieder durch ihre Genossenschaft, ebenso der Genossenschaft durch ihre Mitglieder zu wünschen übrig lässt. Es sollte Einigkeit dahingehend bestehen, dass Unternehmen, die als eG firmieren, niemals eine verselbständigte Einrichtung sein können, vielmehr an das Mitglied gebunden bleiben.[9]
- Deformationserscheinungen des Genossenschaftsmodells
(1) Schwachpunkte in der Führung des „gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs“
Abweichend von der in Festtagsreden vielbeschworenen Unternehmensphilosophie, die genossenschaftliche Grundwerte betont, mangelt es in der täglichen Praxis häufig an erlebbarer Umsetzung. Zu wenig kommt zur Geltung, was hinsichtlich Zusammensetzung und Handeln des Managements zu bedenken wäre. Es fehlt an sichtbarer „Genossenschaftlichkeit“.
Zum Teil geht dieser Mangel darauf zurück, dass in die Führungsebene größerer Genossenschaften zu einem erheblichen Teil außerhalb der Genossenschaftsorganisation rekrutierte Führungskräfte berufen werden. Und weil sie als Vorstände gemäß § 9 Abs. 2 GenG (Prinzip der Selbstorganschaft) Mitglied der betreffenden Genossenschaft sein müssen, werden diese Personen als (die Genossenschaft) „fördernde Mitglieder“ aufgenommen.[10] Mitunter bringen sie ein unklares Vorstellungsbild von einer Genossenschaft mit. Im Extremfall sehen sie im Gemeinschaftsunternehmen der Mitglieder, für dessen Entwicklung und Erfolg sie Verantwortung tragen, ein Unternehmen wie jedes andere. Als Vorstand etwa einer Genossenschaftsbank ist ihnen dann der Teilaspekt „Bank“ deutlich näher als das Strukturelement „Genossenschaft“.[11] Wenn dadurch in den Köpfen der Belegschaft einer größeren Volksbank oder Raiffeisenbank auch noch nicht der Weg von der Genossenschaftsbank zur Bank vorgezeichnet ist[12], so kommt es doch „zu einer gewissen Abkoppelung der Bank- und Vorstandsinteressen von denen der Mitglieder (…).“[13]
Für eine Verankerung im genossenschaftlichen Bewusstsein wäre es notwendig, dass sich neue Führungskräfte mit der Genossenschaftsidee, den Besonderheiten einer Genossenschaft und den Werten einer Genossenschaft vertraut machen, was sich gleichermaßen neue Mitarbeiter anzueignen hätten. „Eigens genossenschaftliche Schulung der Vorstandsmitglieder und Beschäftigten“[14] ist gefragt, um ihnen das, was eine Genossenschaft ausmacht, zu vermitteln. Schließlich obliegt es beiden Gruppen, nach außen zu tragen, wofür die Genossenschaft steht, was ihr Auftrag ist und was sie von anderen Organisationen unterscheidet.
Eine weitere Verfremdungsursache ist im externen Größenwachstum durch Fusion zu sehen, mit der vielmals eine für unumgänglich gehaltene Anpassung an die Branchenentwicklung erreicht werden soll. Bei mehreren Fusionswellen im deutschen Genossenschaftssektor war mitunter der Blick auf Eigenbelange des Genossenschaftsunternehmens wie Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Marktmacht sowie Erzielung von Markterfolg gerichtet, deren Mittel-Zweck-Beziehung zum Förderauftrag jedoch nicht erkennbar wurde. Dass die Schaffung von Genossenschaften mit räumlich ausgedehntem Geschäftsgebiet, größerem Kundenkreis und Geschäftsvolumen nicht zwingend zu einer Steigerung der Fördereffizienz führt, zeigen Erfahrungen in der Praxis. Fusionsbedingte sprunghafte Größenveränderungen wirken sich zudem vielfach negativ auf die genossenschaftsinternen Bindekräfte aus, d. h. auf den Gruppenzusammenhalt, den Kontakt zwischen den Mitgliedern, deren Beteiligung an Willensbildung und Kontrolle sowie die Stabilität der Geschäftsbeziehung der Mitglieder zum Genossenschaftsunternehmen. Verschmelzungen bergen die Gefahr einer Anonymisierung dieser Beziehungsfelder und der Entfremdung in sich, wenn nicht von vornherein die Vermeidung solcher Prozesse mit geeigneten organisatorischen Mitteln betrieben wird.
(2) Die Mitgliedschaft droht zur Formalität zu degenerieren
Weil es der Konkurrenz nicht gelingt, die genossenschaftliche Mitgliedschaft zu imitieren, stellt diese das wohl markanteste Identifikationsmerkmal und eine wertvolle „strategische Ressource“ darstellt. Was einen Wert verkörpert, über den Unternehmen anderen Typs nicht verfügen, macht Genossenschaften unverwechselbar. Doch wie geht die Praxis zum Teil damit um? In Prospektmaterial, das auf die Gewinnung neuer Mitglieder zielt, wird nicht selten damit geworben, dass die Mitgliedschaft einfach zu erwerben sei. Es genügt die Unterschrift der am Beitritt zur Genossenschaft Interessierten unter ein Formular. Sie werden kaum über die durch Gesetz und Satzung bestimmten Mitgliedschaftsrechte wie Teilnahme an Mitgliederversammlungen, Stimmrecht, das aktive und passive Wahlrecht sowie das Recht auf Auskunft und die Organschafts- und vermögensrechtlichen Pflichten eines Mitglieds aufgeklärt. Der Wahrheitsgehalt dieser Aussage lässt sich überprüfen, indem man sich in der Geschäftsstelle einer Genossenschaftsbank nach Details der Mitgliedschaft erkundigt.
In dem Maße, wie die Mitgliedschaft zwar gelegentlich als „Alleinstellungsmerkmal“ betont, aber außerhalb von Werbekampagnen nur zurückhaltend kommuniziert und Mitgliedschaftsanwärtern angetragen wird, findet eine Verwässerung dieses ideellen Kerns einer Genossenschaft bis hin zur bloßen Formalität statt. Bleiben dann während der Zugehörigkeit zum Kooperativ die subjektiven Fördererwartungen aus, die für den Beitritt entscheidend waren, ist der Mitgliedschaft keine wirkliche Bedeutung zuerkannt. Unter solchen Umständen sind die Chancen für eine individuelle Bindung an die Genossenschaft gering. Das Mitglied wird leicht dazu neigen, seine Leistungsbeziehungen auf vorteilhafte Umsatzakte zu beschränken, aber nicht daran interessiert sein, auf der Selbstverwaltungsebene aktiv zu werden.
Es fällt sicher schwer, der Mitgliedschaft einen besonderen Wert abzugewinnen, wenn etwa in der bankgenossenschaftlichen Sparte der Eindruck entsteht, diese organisatorische Zugehörigkeit werde gegen Übernahme von Geschäftsanteilen mit dem Versprechen einer Kapitaldividende „verkauft“. Durch Verblassen des personalistischen Elementes kann ein Klima entstehen, in dem für einen Teil der Trägerschaft die Institution „Mitgliedschaft“, die ein einzigartiges Profilierungsinstrument sein sollte, in die Nähe einer Gelegenheit zu rentabler Kapitalanlage rückt. Häufig wird eine Vernachlässigung des konstitutiven Elementes „Mitgliedschaft“ zum Ausgangspunkt für einen umfassenderen Konturverlust. Für ein positives Selbstverständnis wären demgegenüber eine Aufwertung der Mitgliedschaft und die identitätssichernde Wirkung weiterer Differenzierungspotenziale notwendig.
(3) Genossenschaftsgedanke: Die vielfältige Abkehr vom genossenschaftlichen „Identitätsprinzip“
Das Identitätsprinzip als weiteres Kriterium einer Unterscheidung von anderen Unternehmensformen bezeichnet das personale Gleichsein von Trägern der demokratischen Entscheidungsfindung und Kontrolle, Leistungsnutzern und Kapitalgebern des Genossenschaftsunternehmens. Es ist ein Grundsatz, der überall dort eine Aushöhlung erfährt, wo Geschäfte mit Kunden, die keine Mitglieder sind, getätigt und nichtnutzende Mitglieder geduldet bzw. zugelassen werden. In manchen Sparten des Genossenschaftssektors wurde das Prinzip der Identität von Mitgliedern und Nutzern durch starke Ausdehnung des Zweckgeschäfts auf Nichtmitglieder geradezu abgeschafft.
Das GenG erlaubt Umsatzbeziehungen zu Nur-Kunden faktisch unbegrenzt. Ein mitgliederorientiertes Management sollte indessen um ein „genossenschaftsverträgliches“ Ausmaß in Relation zum „Zweckgeschäft“ mit Mitgliedern bemüht sein, denn nicht erst eine starke Ausweitung des „Fremdgeschäfts“ mit Nichtmitgliedern bedeutet ein Außerkraftsetzen des Identitätsprinzips. Damit wird nicht empfohlen, auf Geschäfte mit Externen zu verzichten. Zweifellos erleichtern sie die Akquisition neuer Mitglieder. Doch sollte ein deutlich überwiegender Teil der Kunden auch Mitglied der Genossenschaft sein, das Nichtmitgliedergeschäft der besseren Mitgliederförderung dienen und als Vorstufe zur Mitgliedschaft genutzt werden.
Besonders bei Bankgenossenschaften ist in der Breite der Wille zur Begrenzung nicht vorhanden. In Einzelfällen übersteigt die Anzahl der Kunden das Doppelte der Mitgliederzahl, so dass die Zahl der Nichtmitglieder-Kunden die Zahl der Mitglieder übertrifft. Damit geht das Nichtmitgliedergeschäft eindeutig über ein – das Zweckgeschäft ergänzendes – Nebengeschäft hinaus. Zwangsläufig erfährt die Mitgliedschaft einen Sinnverlust. Nicht weniger ist dies der Fall, wenn in Geschäftsberichten, im Sprachgebrauch der Werbung von Genossenschaften, ja sogar in Leitbildern mehr und mehr nur „Kunden“ und „Geschäftsfreunden“ und die „Mitglieder“ immer weniger vorkommen und im Extremfall das Mitglied überhaupt nicht mehr erwähnt wird. Es entsteht der Eindruck, als sei eine Unterscheidung von Mitgliedern und Nichtmitgliedern sowie von Mitgliedern als Primärzielgruppe und Nur-Kunden nicht gewollt. Unter diesen Umständen gilt das Mitglied als „normaler“ und substituierbarer Kunde, statt Partner und mit seinen Förderbelangen erstrangiger Bezugspunkt genossenschaftlicher Unternehmenspolitik zu sein.
Deutlich weniger ins Gewicht fällt die Verletzung des Identitätsprinzips durch drei Gruppen von Mitgliedern, die keine Geschäftsbeziehungen zu ihrer Genossenschaft unterhalten:
(1) Zunächst die Nichtkunden-Mitglieder, die sich dem Kooperativ allein aus dem Anlagemotiv heraus anschließen („kapitalverwertende Mitglieder“) oder Leistungen des Genossenschaftsunternehmens später nicht mehr benötigten oder dauerhaft zu anderen Anbietern abwanderten. Häufig sind solche auf der Leistungsebene passive Mitglieder allein wegen der Erwartung einer Kapitaldividende am Fortbestand ihrer Mitgliedschaft interessiert.[15]
(2) Als „Gipfelpunkt der genossenschaftlichen Entartung“ gilt vielen[16], wenn Genossenschaften von der Möglichkeit einer Aufnahme lediglich „investierender“ Mitglieder gemäß § 8 Abs. 2 GenG Gebrauch machen. Investoren-Mitglieder beteiligen sich mit Kapital, kommen jedoch für die Inanspruchnahme von Förderleistungen der Genossenschaft nicht in Betracht. Deren Interesse ist auf die Erzielung einer möglichst hohen Rendite auf ihr Beteiligungskapital gerichtet. Mit diesen Mitgliederkategorien wird der Grundsatz des § 1 GenG verletzt, wonach die Mitglieder über Leistungsbeziehungen zu fördern sind, was von diesem Personenkreis entweder nicht gewollt oder mangels Bedarf an Leistungsbeziehungen nicht möglich ist.
(3) Der Vollständigkeit zu erwähnen ist die Kunstfigur des „fördernden Mitgliedes“[17], das nur formell die Mitgliedschaft erwirbt, um dem Prinzip der Selbstorganschaft genügend dem Vorstand einer Genossenschaft angehören zu können. In der Regel können diese Mitglieder mangels unternehmerischer Betätigung im Sinne des in der Satzung der Genossenschaft fixierten “Gegenstandes des Unternehmens“ von vornherein nicht dessen Geschäftspartner sein.
Besonders mit dem Vorkommen investierender Mitglieder dringt ein kapitalistisches Element in die Genossenschaft ein. Andererseits muss bedacht werden, dass die Investoren „mit ihrer Kapitaleinlage den förderwirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der Genossenschaft unterstützen (…).“[18]
(4) Auf dem Weg zu einem austauschbaren Geschäftspartner
Fehlende klare Präferenzen für die Trägergruppe können im Mitgliederkreis Unzufriedenheit und daraus folgend eine allmähliche Auszehrung individueller Mitgliederbeziehungen zur Genossenschaft hervorrufen. Mitgliederbewusstsein und Gemeinsinn in der Trägerschaft schwinden, ebenso die individuelle Identifikation mit der Genossenschaft. Die eintretende Entfremdung äußert sich zunächst in zunehmender Passivität in der Organisationsbeziehung, d. h. in geringer Bereitschaft zur Mitgestaltung und Kontrolle. In einer weiteren Stufe droht abnehmende Leistungsfrequenz. Ein Teil des Mitgliedergeschäfts nimmt den Charakter von Marktbeziehungen an.
Geringe Wertschätzung als Geschäftspartner durch die Genossenschaft kann den Mitgliedern auf die Dauer nicht verborgen bleiben. Ihnen wird bewusst, dass sie mit der Mitgliedschaft verbundene „Beiträge“ an die Genossenschaft (Bildung von Geschäftsguthaben, Mitwirkung an der Selbstverwaltung, Übernahme einer Haftpflicht) zu leisten haben, die Nichtmitglieder-Kunden nicht abverlangt werden können. Stehen diesen Lasten keine kompensierende Vorteile materieller oder immaterieller Art gegenüber, wie dies bei ausbleibender Förderdifferenzierung zwischen Mitgliedern und Nur-Kunden der Fall ist, fühlen sich Mitglieder zu Recht diskriminiert.[19] Mitgliederbezogene Förderauftragserfüllung wird von den Führungskräften mitunter als Last empfunden und verdrängt. Der Förderauftrag existiert „auf dem Papier“, nämlich in der Satzung, wird allerdings mit der Erklärung unterlaufen, es sei schwierig bis unmöglich, den Förderauftrag zu operationalisieren, d. h. in griffige Handlungsanweisungen umzusetzen.[20] Doch gerade die Konkretisierung des Förderzwecks auf die ermittelten Mitgliederbedürfnisse hin ist nach dem Willen des Gesetzgebers eine vom genossenschaftlichen Management zu leistende Aufgabe. Förderpassives Verhalten einer Genossenschaft wird dadurch erleichtert, dass sich der Zwang, Mitgliederwert zu schaffen, abschwächt, wenn die Genossenschaft auf Nichtmitgliedergeschäfte ausweichen kann.[21]
Fördergeschäftsgleiche Beziehungen größeren Stils zu Drittkunden und ein Verzicht auf Exklusivvorteile für Mitglieder dürften auf die Dauer nicht ohne Konsequenzen bleiben. Ein Teil der Mitglieder wird den Sinn der Mitgliedschaft in der als Selbsthilfeorganisation gedachten Vereinigung infrage stellen.[22] Es besteht die Gefahr, dass Mitglieder, die sich von der Genossenschaft vernachlässigt fühlen, ihrerseits die Genossenschaft vernachlässigen.[23] Sie fühlen sich nicht mehr zur aktiven Mitarbeit in der Genossenschaft und zur regelmäßigen Teilnahme am Geschäftsverkehr mit dem Gemeinschaftsunternehmen verpflichtet und die Genossenschaft wird nur fallweise zwecks Nutzung günstiger Angebote frequentiert. Ansonsten wenden sich Mitglieder anderen Anbietern zu. Damit wird nicht nur das Mitglied für die Genossenschaft, sondern auch die Genossenschaft zu einem ganz gewöhnlichen, austauschbaren Geschäftspartner. Partielle Abkehr von „Genossenschaftstreue“ kann in einen Verzicht auf jegliche Umsatzbeziehungen zur Genossenschaft (Nichtkunden-Mitglied) übergehen und schließlich mit dem Austritt aus dem Kooperativ enden.
(5) Weitreichende Entscheidungsautonomie des Leitungsorgans
Das GenG hat in § 27 Abs. 1 die Zuständigkeit in Geschäftsführungsangelegenheiten den eigenverantwortlich-unternehmerisch operierenden, durchweg hauptamtlichen Geschäftsleitern übertragen. Diese Stärkung der Leitungskompetenz ist „als Begründung einer Vorstandsallmacht kritisiert worden, die zu einem unvertretbaren Übergewicht des Vorstandes im Machtbereich der eG beigetragen habe.“[24] Ist dem Vorstand nicht bewusst und wird in dessen Handeln nicht erkennbar, dass er die Geschäfte eines Unternehmens der Mitglieder zu führen, diesen zu dienen und sich dabei nachdrücklich an deren Bedürfnissen zu orientieren hat, ist mit Entfernung der Leitung von der Mitgliederbasis und mit nachlassender Berücksichtigung der Mitgliederbelange in Führungsentscheidungen zu rechnen. Dies wiederum dürfte nicht ohne negative Auswirkung auf die Genossenschaftsorientierung der Mitglieder bleiben.
Auf der anderen Seite wird der Einfluss der Trägergruppe auf die Willensbildung im inneren Machtgefüge zurückgedrängt, wenn managementdominierte Genossenschaften von der Generalversammlung zur Vertreterversammlung, mithin von direkter Mitwirkung aller interessierten Mitglieder in der basisdemokratischen Generalversammlung zur mittelbaren oder repräsentativen Demokratie in der Vertreterversammlung übergehen.[25] Der Wechsel zum Vertreterprinzip erfolgt mitunter allzu früh, indem die Vorschrift des § 43a Abs. 1 GenG, wonach bei mehr als 1.500 Mitgliedern die Generalversammlung durch Vertreter ersetzt werden kann, in der Praxis wie eine Muss-Vorschrift gehandhabt wird. Es ist dann kaum auszuschließen, dass aufgrund einer nur unzureichend an das interne Kommunikationsnetz angeschlossenen Basis dem „gewöhnlichen“ Mitglied Informationen über wichtige Angelegenheiten der Genossenschaft, Förderintentionen des Managements und Effizienz des Handels auf der Funktionärsebene (Vertreter, Aufsichtsrat) entgehen. Schließlich können unvollkommen informierte Mitglieder getroffene Führungsentscheidungen nur begrenzt beurteilen.
Im Größenwachstum einer Genossenschaft wird der Wechsel zur Vertreterversammlung unvermeidlich und führt zur Ausgrenzung eines Großteils der Mitglieder von der genossenschaftlichen Willensbildung und Kontrolle[26], mithin zu Demokratieschwund und Schwächung der Selbstverwaltung des gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs. Dies ruft eine passive Einstellung nicht weniger Mitglieder zu ihrer Genossenschaft hervor. Zudem fehlt es häufig an Kontakt zwischen den Vertretern und den durch sie vertretenen Mitgliedern. Besonders mit einem frühen Übergang zum Vertreterprinzip wird die Mitgliederdemokratie ohne Not unterlaufen, was in Widerspruch zu dem steht, was in Leitbildern genossenschaftlicher Verbände als Erfolgsrezept empfohlen wird: Pflege und aktivierende Aufwertung des Mitgliedschaftsgedankens. Verzichtet eine Genossenschaft bei Ablösung der Generalversammlung auf die Schaffung ersatzweiser Kommunikationsgelegenheiten, wird nicht bedacht, dass Einbindung der Mitgliederbasis die Verwirklichung von Management-Zielen unterstützen kann. Spätestens dann stellt sich die Frage, ob der Trend zur Verselbständigung der Leitung einer eG zur Beschneidung der Teilhaberechte der Mitglieder, zu deren Entmündigung der Mitglieder, zur Bedeutungslosigkeit der genossenschaftlichen Demokratie und Zurückdrängung des Ehrenamtes in der Genossenschaft führen muss.[27]
(6) Der Umgang mit der Akquisitionsplattform „Nichtmitgliedergeschäft“
Ein umfangreicher Leistungsaustausch mit Nichtmitgliederkunden steht in Widerspruch zur Konstruktion einer Genossenschaft, weil sie dadurch partiell den Charakter einer Erwerbsgesellschaft annimmt und die Mitgliedschaft eine Abwertung erfährt. Dessen ungeachtet existiert das Nichtmitgliedergeschäft fast im gesamten genossenschaftlichen Wirtschaftssektor, und in bestimmten Sparten hat man sich an ein umfangreiches „Fremdgeschäft“ gewöhnt.[28] Zwar wird in der Kommunikation von Genossenschaften nach außen die Mitgliedschaft als Alleinstellungsmerkmal propagiert, doch fehlt es oft am Bemühen, durch aktives Heranführen langjähriger Nur-Kunden an die Trägerschaft dem werbepolitischen Argument für das Nichtmitgliedergeschäft Glaubwürdigkeit zu verschaffen. Mitunter schotten sich Genossenschaften auch gegen die Aufnahme neuer Mitglieder ab. So bleibt das Nichtmitgliedergeschäft ein Dauerthema und Gegenstand kontroverser Diskussionen.
Selbst ein ausuferndes Fremdgeschäft wird gewöhnlich damit begründet, dass es für die Gewinnung neuer Mitglieder aus dem Kreis der Nur-Kunden notwendig sei. Bei dauerhaft hohem Anteil der Nichtmitglieder an der Gesamtkundenzahl erscheint diese Absicht allerdings nicht nachvollziehbar. Es scheint, als werde im Nichtmitglieder-Kunden immer weniger ein potenzielles künftiges Mitglied gesehen. Denn wo Kunden- und Mitgliederzahl weit auseinanderklaffen, darf unterstellt werden, dass dieser Zustand nicht mit der Absicht herbeigeführt wurde, die Nur-Kunden binnen absehbarer Zeit dem Mitgliederkreis zuzuführen. Im Übrigen behielte das Nichtmitgliedergeschäft seine Bedeutung als Instrument zur Werbung neuer Mitglieder auch dann, wenn es einen den Geschäftsverkehr mit Mitgliedern lediglich ergänzenden Charakter aufweisen würde.[29] Das Nichtmitgliedergeschäft ist vielerorts zu einer „tragenden Säule“ der Geschäftstätigkeit geworden und hat den Rang eines „normalen“ Geschäftes angenommen.
Damit einher geht ein Marketing, das auf nennenswerte Vorteile für die Mitglieder verzichtet, was in annähernd gleichen Konditionen für Mitglieder- und „Fremdkunden“ zum Ausdruck kommt. Außer einer Dividende, die ohnehin nur Mitgliedern zugutekommen kann, sind zeitweise keine „Anreize“ für Mitglieder-Kunden auszumachen. Durch eine Geschäftspolitik der generellen Kundenorientierung geraten Genossenschaften auf die Entartungsspur, und Mitglieder, die sich mit organisationsfremden Kunden gleichgestellt sehen, fühlen sich falsch behandelt. Bleibt eine wirtschaftliche Vorzugsförderung der Mitglieder primär auf der Hauptleistungsebene aus, tendiert das Kooperativ zur bloßen „Dividendengenossenschaft“.[30]
Weshalb sollten Drittkunden ein Interesse am Beitritt haben, wenn sie erstens in ihrer Außenseiterrolle zeitlich unbefristet von der Genossenschaft geduldet werden, zweitens aus dem Leistungsverkehr mit der Genossenschaft weitgehend den gleichen Nutzen ziehen können wie ein
Mitglied, so dass ihnen die Mitgliederposition nicht attraktiv erscheint. Vor allem das Ausbleiben einer die Mitglieder bevorzugenden Geschäftspolitik, etwa durch Abgabe bestimmter Leistungen nur an Mitglieder, steht einem Verlassen der Außenseiterposition entgegen. Bisherige Nur-Kunden sehen dann keinen Sinn darin, Mitglied zu werden.[31] Zwecks Aufwertung der Mitgliedschaft und Vermeidung einer Vernachlässigung oder gar eines Vergessens der Förderzweckbindung an die Mitglieder wäre ein Gefälle zwischen Mitglieder- und Nichtmitgliederförderung notwendig. Aus dem Mehr an Förderung, das die Mitglieder erfahren, erwächst die Attraktivität der Mitgliedschaft. Schließlich ist zu bedenken, dass die Genossenschaftsleitung durch das Drittkundengeschäft eine gewisse Unabhängigkeit von den individuellen Frequenzgraden im Mitgliedergeschäft erlangt. Dadurch kann die Mitgliederorientierung zurückdrängt und das Genossenschaftsmanagement dazu verleitet werden, Nur-Kunden am Förderpotenzial teilhaben zu lassen.
- Genossenschaftsbanken: Wohin geht der Weg?
Den Bankgenossenschaften wurde Anerkennung dafür zuteil, dass sie die Finanzkrise im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts ohne bemerkenswerten Schaden überwunden haben. Und zwar „mit ihren eigenen Mitteln … und nicht auf Kosten anderer“, wie Papst Franziskus am 12. September 2015 vor 7.000 Mitarbeitern der Genossenschaftsbank von Rom lobend hervorhob.[32]
Für die Kreditgenossenschaften in Deutschland finden wir für 2014 folgende Daten veröffentlicht: 1.065 Genossenschaftsbanken mit 12.332 Bankstellen, 18.025 Mitgliedern, 192.896 Mitarbeitern, weiter gestiegenen Marktanteilen, einem Jahresüberschuss von 7,8 Mrd. Euro.[33] Zahlen, die belegen, dass es dieser Sparte des Genossenschaftssektors nicht an wirtschaftlicher Stärke fehlt und sie sich im Wettbewerb zu behaupten wissen. Doch wie steht es mit der genossenschaftsspezifischen Substanz?
Besonders im Zusammenhang mit der Finanzkrise und aus Anlass des „Internationalen Jahres der Genossenschaften 2012“ besannen sich die Kreditgenossenschaften zumindest verbal auf ihren „kulturellen Kern“, auf das, was sie von kommerziellen Unternehmen unterscheidet. In ihren Werbekampagnen widmeten sie sich dem Thema „Mitgliedschaft als Alleinstellungsmerkmal“, und bekundeten, dass Werte wie Glaubwürdigkeit, Nachhaltigkeit, Nähe zum Kunden oder Regionalität gepflegt werden, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Dabei wurde deutlich, dass solche Werte nicht nur in Leitlinien des Managements und in der Unternehmensstrategie zu verankern, sondern von Führungskräften und Mitarbeitern im Geschäftsalltag auch zu leben sind.
Um dies überzeugend leisten zu können, wäre es für die Akteure von Nutzen, nicht nur über ein solides Wissen bankbetrieblicher Art, sondern auch über den Sinn und Zweck einer Genossenschaft zu verfügen und verinnerlicht zu haben: Die Mitglieder haben ein Unternehmen, dem als einziger Zweck zugewiesen ist, sie zu fördern. Dieser Förderauftrag war und ist das absolute Wesensprinzip der Genossenschaften, den es im Einzelfall zu konkretisieren, d. h. an den zu erkundenden Bedürfnissen der Mitglieder orientiert zu erfüllen gilt. Wohlklingende öffentliche Bekenntnisse erweisen sich als nutzlos, wenn deren Inhalt unklar bleibt und im tatsächlichen Handeln ausbleibt – eine Gefahr, die generell von Werteproklamation und schlagwortartigen sonstigen Bekundungen auszugehen droht.
Zweifelsfrei sind nicht alle Genossenschaften und nicht alle Kreditgenossenschaften von den erwähnten Verfremdungen betroffen. Das ändert freilich nichts daran, dass das Phänomen Verfremdung seit einiger Zeit existiert und deshalb dringender Bedarf besteht, darüber zu diskutieren. Denn nicht wenige der angeführten Erscheinungen sind im genossenschaftlichen Bankensektor anzutreffen, nach herrschender Meinung stärker als in anderen Sparten des deutschen Genossenschaftssektors vertreten. Ein Beispiel hierfür mag an dieser Stelle genügen: Die Geschäfte von Kreditgenossenschaften werden in umfangreichem Stil mit Nichtmitgliedern getätigt. Infolge der Politik einer für Außenstehende weit geöffneten Tür nehmen diese Genossenschaften den Charakter generell kundenorientierter „Publikums-Unternehmen“ an, deren hohe Gesamtkundenzahl als Zeichen für Attraktivität und großes Mitglieder-Zuwachspotenzial geschätzt wird. Vor allem größere Kreditgenossenschaften haben sich zu typischen „Marktbeziehungs-Kooperativen“ (Dülfer)[34] entwickelt.
Gewiss befinden sich die Banken und darunter eben auch die Volksbanken und Raiffeisenbanken immer wieder im Umbruch, was ihnen ständig abfordert, wettbewerbsfähig zu bleiben. Man kann durchaus der Meinung sein, der genossenschaftliche Bankenverbund würde in der aktuell vorzufindenden Gestalt und Stärke nicht existieren, wenn sich die Primärinstitute im Spannungsfeld zwischen Bewahrung und Wandel das Geschäftsmodell nicht zügig an veränderte Bedingungen angepasst hätten. Gleichwohl sind die über eine lange Zeitstrecke in der Praxis stattgefundenen, seitens der Genossenschaftswissenschaft kritisierten struktur- und prozessbezogenen Umbildungen als Indiz für einen Einstellungs- und Wertewandel zu deuten.
Die Rechtsform eG ist dafür kaum verantwortlich zu machen. Sie hat sich seit dem 19. Jahrhundert als Unternehmensform bewährt und gilt unverändert als ein Modell für die Zukunft. Genossenschaftsbanken müssen sich als Bank bewähren. Das heißt: Neue Herausforderungen, wie sie z. B. die digitale Transformation stellt, meistern, indem omnikanalfähige Produkte angeboten werden, zudem mit flexiblen Unternehmensstrukturen die Effizienz gefördert wird, um im Konzert der Wettbewerber erfolgreich mitspielen zu können. Anderseits sollten sie so genossenschaftlich wie möglich bleiben, vor allem mitgliederorientiert, solange sie in der eG-Rechtsform auftreten. Das bedeutet auch: Erhaltung eines genossenschaftstypischen Profils, was vor allem verlangt, die vom Gesetzgeber verordnete „Förderung der Mitglieder“ ständig mit neuem Leben zu füllen.
Wohin geht der Weg der primärgenossenschaftlichen Bankinstitute? Dabei interessiert vor allem die Frage, welcher Umgang mit der verbliebenen genossenschaftlichen Substanz zu erwarten ist. Voraussagen sind subjektiv gefärbt und auf längere Sicht überdies schwierig. Mit aller Vorsicht darf man für die nächsten Jahrzehnte folgende Prognosen wagen:
- Kreditgenossenschaften haben eine Zukunft.[35] Es wird sie weiterhin geben, zwar mit zunehmendem Größenwachstum überwiegend mit regionalem Geschäftsgebiet und entsprechend weitem Zweigstellennetz.
- Auch die für die deutsche Bankwirtschaft charakteristische Drei-Säulen-Struktur wird fortbestehen. Konkurrenten der Genossenschaftsbanken werden also weiterhin öffentlich-rechtliche Kreditinstitute und private Geschäftsbanken sein.
- Der Konzentrationsprozess setzt sich nach den vorausgegangenen Fusionswellen moderat fort. Weniger dadurch, dass sich Raiffeisen- und Volksbanken jeweils untereinander vereinen, sondern zunehmend durch den Zusammenschluss von Raiffeisen- und Volksbanken zu VR-Banken.
- Bei fortschreitender Automation des Bankenverkehrs ist mit einer Reduzierung der Zweigstellenzahl insbesondere in Stadtgebieten zu rechnen. An den verbleibenden dezentralen Standorten werden den Kunden auch künftig Bankmitarbeiter zur Verfügung stehen, da bestimmte Dienste sind nur in unmittelbar-persönlicher Präsenz zu erbringen sind.
- Auch in 20 Jahren werden sowohl Mitglieder als auch Nur-Kunden Geschäftspartner der Genossenschaftsbanken sein, wobei Nichtmitglieder nicht mehr als „Fremdkunden“ empfunden, sondern ebenso wie Mitglieder-Kunden geschätzt sind. Auch künftig wird man sich schwer damit tun, den mitgliederbezogenen Förderauftrag nicht zu einer hohlen Phrase werden zu lassen. Dieses wesentliche Problem wird vielfach von betriebswirtschaftlichen Erfordernissen überdeckt.[36]
- Mitglieder werden zwar benötigt, um die Selbstverwaltung aufrechterhalten zu können, was die Firmierung als eG verlangt. Dennoch wird die Neigung fortbestehen, auf eine spürbare Besserstellung der Mitgliederkunden zu verzichten, und zwar mit der gängigen Begründung, die Erfordernisse des Wettbewerbs würden dies nicht erlauben. Anziehungskraft wird nach wie vor von einer zufriedenstellenden Dividende ausgehen. Vor allem damit wird versucht, Mitglieder zu akquirieren und zu halten.
- Anreize zum Erwerb der Mitgliedschaft sind im Bereich der nicht-ökonomischen Förderkomponenten (Kundennähe, sachkundige und individuelle Beratung, Freundlichkeit u. a.) kaum zu bieten, da hier Vorteile für Mitglieder, in denen Außenstehende einen Beitrittsanreiz sehen, weder möglich noch darstellbar sind.
- Im Spannungsfeld von genossenschaftlicher Tradition und wettbewerbsbedingter Anpassung stehend, könnte von vielen Instituten das traditionelle Element als Last empfunden werden und an Bedeutung verlieren. Als Konsequenz daraus steht für Bankgenossenschaften der Teilaspekt „Bank“ im Vordergrund, während das „Genossenschaftliche“ weiter in den Hintergrund tritt.
- Wird das reale Verhalten in der genossenschaftlichen „Bankenlandschaft“ das aktuell bestehende Identitätsproblem noch verstärken, darf bezweifelt werden, ob die eG für diese Sparte das geeignete Organisationsmodell ist.[37]
- Der Rechtsformwandel in eine Aktiengesellschaft wird in der Praxis ein Diskussionsgegenstand sein und nicht wenigen Führungskräften größerer Genossenschaftsbanken als Wunschbild vorschweben, doch dürfte die Zahl der Umgründungen in eine andere Unternehmensform wie bisher gering bleiben.
Wenn auch nur ein Teil dieser Mutmaßungen eintritt, werden die Genossenschaftsbanken weiter vom typischen Profil einer Genossenschaft abweichen. Da liegt die Frage nahe, die hier nicht zum ersten Mal gestellt wird: „Wofür werden solche Banken dann noch benötigt?“[38] Ihre Existenz macht im Grunde nur dann einen Sinn, wenn die Kreditgenossenschaften eine Perspektive als Bank, aber auch als Genossenschaft haben. Das verlangt, dass sie nicht nur nach Bestandserhaltung, Markterfolg und Gewinnerzielung streben, sondern auch genossenschaftlicher Unternehmenskultur und Fördererfolg ein hoher Stellenwert eingeräumt und die Mitgliedschaft als Markenzeichen verstanden wird.
- Zusammenfassende Schlussbemerkungen
Es zeigt sich, dass die Verfremdung von Genossenschaften zu einem wesentlichen Teil begründet liegt in der Tendenz zur Großgenossenschaft, mangelndem Genossenschaftsbewusstsein auf der Führungsebene und im Mitgliederkreis, wachsender Verselbständigung des Genossenschaftsunternehmens und nachlassender Mitgliederorientierung der Genossenschaft, abnehmender Genossenschaftsorientierung der Mitglieder, Identitätsschwund durch zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber der Mitgliedschaft und Lockerung der Beziehungen zwischen den Mitgliedern. Damit befindet sich das Leitbild der genossenschaftlichen Rechtsform seit geraumer Zeit auf dem Weg der „Entgenossenschaftlichung“[39] – ein Befund, der nicht zu übersehen ist und bedenklich stimmen muss.
Man fragt sich, wie viele und welche Modifikationen die genossenschaftliche Unternehmensform verträgt und ob dort, wo das Genossenschaftliche in einen Auflösungsprozess geraten ist, Einsicht und Absicht vorhanden sind, diesen Zustand zu ändern, indem einerseits arteigene, als Elemente eines strategischen Differenzierungskonzepts bewährte Wesenselemente gestärkt und andererseits neue Entwicklungen adoptiert werden, die Markt- und Fördererfolg versprechen. Das würde den betreffenden Genossenschaften neben geeigneter Marktgestaltung und betriebswirtschaftlicher Effizienz abverlangen: Hervorhebung alles dessen, was Identität schafft, nämlich
u. a. die nicht imitierbaren Mitgliedschaft, zeitgemäße genossenschaftliche Werte und den mitgliederbezogenen Förderanspruch.[40] Aller Voraussicht nach dürfte die „genossenschaftliche Rechtsform (..) nur dann ihre Zukunft haben, wenn (…) vor allem jene ihrer Wurzeln immer wieder freigelegt werden, die für die Rechtsform der Genossenschaft identitätsbegründend sind.“[41] Andernfalls ist ihre Glaubwürdigkeit, ja ihre Existenzberechtigung kaum vorstellbar.
Durch Nähe zum Mitglied Systemvertrauen aufzubauen, den „kulturellen Kern“ zu bewahren und Anziehungskraft zu entwickeln, um nötigenfalls eine Rückbindung an die Mitglieder in Gang zu setzen, sollte im Grunde ein selbstverständliches Anliegen sein. Ohne Mitgliederzentriertheit verlieren die Existenz und die Wirtschaftsbetätigung genossenschaftlicher Unternehmen ihren Sinn. Mitglieder, in deren Wahrnehmung die Genossenschaft sie als zentralen Bezugspunkt mehr oder weniger aus den Augen verloren hat, werden sich kaum mit ihr verbunden fühlen oder motiviert sein, sich als Dauerkunde an den gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu binden und sich in der Selbstverwaltung zu engagieren.[42] Häufig wird eine Vernachlässigung des konstitutiven Elementes „Mitgliedschaft“ zum Ausgangspunkt für einen umfassenderen Konturverlust.
In eigener Sache: Du willst etwas verändern? GenoLeaks braucht Deine Unterstützung!
[1] Vgl. Günther Ringle: Wettbewerbsvorteile durch Nutzung spezifischer Differenzierungspotenziale der genossenschaftlichen Kooperationsform, in: Hans H. Münkner/Günther Ringle (Hrsg.): Alleinstellungsmerkmale genossenschaftlicher Kooperation – Der Unterschied zählt, Göttingen 2008. S. 29. (28-49)
[2] Vgl. Hans-H. Münkner/ Günther Ringle (Hrsg.), a. a. O., Vorwort S. VI.
[3] Unternehmen in anderer Rechtsform, ob Kapital- oder Personengesellschaften, können jeden beliebigen Zweck verfolgen.
[4] Vgl. Astrid Engels: Stärkung des Genossenschaftsgedankens durch die Aktualität der Kooperationsidee in Wissenschaft und Wirtschaftspraxis, in: Hans-H. Münkner/Günther Ringle (Hrsg.): Zukunftsperspektiven für Genossenschaften, Bern-Stuttgart-Wien 2006, S. 9. (1-18)
[5] Vgl. dazu Axel Bialek (wie Fn 2), S. 231.
[6] Helmut Wagner: Mitgliederbindung – zwei Seiten der gleichen Medaille, in: Herkunft und Zukunft – Genossenschaftswissenschaft und Genossenschaftspraxis an der Wende eines Jahrzehnts, a. a. O, S. 29 (23-31)
[7] Mitgliederpassivität zeigt sich nur in nachlassender funktionaler Bindung an das Gemeinschaftsunternehmen, sondern auch in der Organisationsbeziehung zur Genossenschaft, etwa in abnehmendem Interesse am internen Geschehen der Genossenschaft und daraus folgendem geringem Engagement.
[8] Vgl. Axel Bialek (wie Fn 2), S. 249.
[9] Vgl. Axel Bialek (wie Fn 2), S. 27 und 153 ff.
[10] Diese Konstruktion stellt für sich eine Verfremdung dar, weil diese Personen vielfach mit der Genossenschaft, in der sie beschäftigt sind, nicht in einen Fördergeschäftsverkehr eintreten können, was in der Regel auf landwirtschaftliche und gewerbliche Genossenschaften zutrifft, deren Mitglieder vom Unternehmensgegenstand der Genossenschaft her Bauern, Handwerker oder Händler sind.
[11] Eine Plattform hierfür liefern die in § 27 Abs. 1 GenG festgeschriebene Eigenverantwortlichkeit und unaufhaltsam betriebene Verselbständigung des Vorstandes von den Mitgliedern als den Gründern und Eigentümern der Genossenschaft. Als Indiz dafür mag gelten, dass Führungskräfte bedenkenfrei von „ihrer“ Genossenschaft sprechen.
[12] Vgl. Hans H. Münkner: Mitgliedschaft als Alleinstellungsmerkmal von Genossenschaften, in: Hans-H. Münkner/ Günther Ringle (Hrsg.), a. a. O., S. 5.
[13] Vgl. Jost W. Kramer: Fortschrittsfähigkeit gefragt: Haben die Kreditgenossenschaften als Genossenschaften eine
Zukunft? Wismarer Diskussionspapiere Heft 01/2003, S. 22.
[14] Vgl. Volker Beuthien: Die eingetragene Genossenschaft. Idee und Wirklichkeit, Baden-Baden 2013, S. 247.
[15] Verständliches Unbehagen am Vorkommen nichtnutzender Mitglieder und die Sorge, das schlechte Beispiel könnte Nachahmer finden, veranlasste in neuerer Zeit einzelne Bankgenossenschaften zu dem Versuch, sich von Nichtkunden-Mitgliedern zu trennen, die seit Längerem keine Geschäftsverbindung mehr mit der Genossenschaft unterhielten. Diesen legten sie nahe, ihre auf Kapitalbeteiligung reduzierte Mitgliedschaft zu kündigen.
[16] Volker Beuthien (wie Fn 14), S. 27.
[17] Vgl. Wilhelm Jäger: Die Selbstverwaltung als Typen bestimmendes Merkmal. Zur Frage einer Modernisierung des Genossenschaftsgesetzes, in: ZfgG Bd. 51 (2001), S. 145 und 147. (139-154)
[18] Volker Beuthien (wie Fn 14), S. 33.
Nicht auszuschließen ist ein Interessenkonflikt innerhalb des Mitgliederkreises, da nutzende Mitglieder vorrangig nach günstigen Konditionen, hingegen nichtnutzende Mitglieder nach einer hohen Kapitalverzinsung streben..
[19] Kurioserweise wird eine ausbleibende Differenzierung zwischen Mitglieder- und Nichtmitgliederförderung mit der nicht nachvollziehbaren Begründung, die Nichtmitglieder dürften nicht diskriminiert werden, unterlassen.
[20] Vgl. Rolf Steding: Reflektionen zur Architektur eines reformierten deutschen Genossenschaftsrechts, in: Fortbildung des deutschen Genossenschaftsrechts, Vorträge und Aufsätze des Forschungsvereins für Genossenschaftswesen (FOG) Heft 23, Wien 2000, S. 21 (9-32)
[21] Vgl. Günther Ringle (wie Fn 1), S. 33.
[22] Vgl. Volker Beuthien (wie Fn 14), S. 245.
[23] Vgl. Jost W. Kramer (wie Fn 13), S. 14.
[24] Rolf Steding (wie Fn 20), S. 21. Aus heutiger Sicht ist es müßig, darüber zu diskutieren, ob diese Regelung der „Machtergreifung des Managements“ Vorschub leistete (Wilhelm Jäger: Fühlen wir uns noch als Mitglieder unserer Genossenschaften, Hardehauser Beiträge Heft 37, Hardehausen 1977, S. 9) oder im GenG nur fixiert wurde, was in größeren Genossenschaften bereits „herrschende Übung“ war.
[25] Zu den genossenschaftlichen Wesensprinzipien zählt die Selbstverwaltung, die häufig auch als „demokratische Selbstverwaltung“ bezeichnet wird. Streng genommen kann dieser Begriff nur auf die Generalversammlung Anwendung finden, zu der alle Mitglieder einer Genossenschaft Zugang haben. Hingegen sollte die Vertreterversammlung, obgleich sie der Selbstverwaltung zuzurechnen ist, nicht als „demokratisch“ im eigentlichen Sinn genannt werden. Die Begriffsbildung „mittelbare Demokratie“ verschleiert den Sachverhalt.
[26] Im Gegensatz dazu wird einem Aktionär der Zutritt zur Hauptversammlung der AG nicht verwehrt.
[27] Vgl. Rolf Steding (wie Fn 20), S. 27 f.
[28] Vgl. Rolf Steding: Genossenschaftsrecht, Baden-Baden 2002, S. 110.
[29] Nicht minder plausibel erscheint das Argument, eine am Markt erfolgreiche Genossenschaft, die eine konsequente Mitgliederförderung betreibt, könne ohne den Umweg über das Nichtmitgliedergeschäft neue Mitglieder gewinnen. Die in ihrem Umfeld bekannte Förderstärke wird hinreichend Beitrittsinteresse wecken, und zumindest als Instrument zur Werbung neuer Mitglieder wäre das Fremdgeschäft entbehrlich.
[30] Wird zudem die nicht als „genossenschaftsgemäß“ anerkannte Kapitalbeteiligungsdividende einer Dividende oder Rückvergütung nach Maßgabe des Geschäftsumfangs mit dem Genossenschaftsunternehmen vorgezogen, sieht manches Mitglied in der Genossenschaft vornehmlich eine Kapitalanlagestelle.
[31] Ein Teil der Nur-Kunden wird es grundsätzlich ablehnen, eine Mitgliedschaft einzugehen, nicht bei Genossenschaften und auch nicht anderswo. Und wenn Nichtmitglieder prüfen, ob sich die Mitgliedschaft für sie lohnt, sollte auch die Genossenschaft abwägen, ob der mitgliedschaftliche Anschluss Außenstehender für sie und für den bereits vorhandenen Mitgliederkreis vorteilhaft ist. Da sich nicht alle Externen für die Aufnahme als Mitglied eignen, bedarf es der Abgrenzung jener, mit der die Genossenschaft auf längere Sicht zusammenarbeiten möchte.
[32] Papst lobt Genossenschaftsbanken. Genossenschaftsbanken tragen zur Humanisierung der Wirtschaft bei.
https://dkm.de/homepage/papst-lobt-Genossenschaftsbanken.html, abgerufen am 21.10.2015
[33] Vgl. Michael Stappel: Die deutschen Genossenschaften 2015. Entwicklungen – Meinungen – Zahlen, Wiesbaden 2015, S. 10-13 und 42-45.
[34] Vgl. dazu Eberhard Dülfer: Betriebswirtschaftslehre der Genossenschaften und vergleichbarer Kooperative,
- Aufl., Göttingen 1995, S. 94-97.
Der Genossenschaftstyp einer „Marktgenossenschaft“ ist durch volle Ausprägung des Unternehmenscharakters, Verselbständigung des hauptamtlichen Managements, Abrücken vom Identitätsprinzip durch ein ausgedehntes Nichtmitgliedergeschäft, Kundenorientierung und marktähnliche Geschäftsbeziehungen der Mitglieder zur Genossenschaft gekennzeichnet.
[35] Vgl. Jost W. Kramer (wie Fn 9), S. 22.
[36] Vgl. ders., a. a. O., S. 17 f. (sowie die dort angegebene Literatur) und S. 22.
[37] Vgl. dazu das Vorwort der Herausgeber zu Rolf Steding: Genossenschaftsbanken: quo vadis? – Eine juristische Betrachtung, Hamburger Beiträge zum Genossenschaftswesen 23, Hamburg 2000.
[38] Jost W. Kramer (wie Fn 9), S. 22.
[39] Vgl. Rolf Steding: Reflektionen über die genossenschaftliche Rechtsform unter marktwirtschaftlichen Bedingungen, Berliner Beiträge zum Genossenschaftswesen 10, Veröffentlichungen des Instituts für Genossenschaftswesen an der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin 1993, S. 41.
[40] Vgl. Berthold Eichwald: Ernüchterung im Investmentbanking und Virtual Banking: Chancen für Genossenschaftsbanken?, in: Manfred Neumann/Berthold Eichwald: Genossenschaftsbanken im Wettbewerb, Veranstaltungen 21 des Forschungsinstituts für Genossenschaftswesen an der Universität Erlangen-Nürnberg, Nürnberg 2003, S. 23 f. (19-27)
[41] Rolf Steding (wie Fn 17), S. 28.
[42] Vgl. Helmut Wagner (wie Fn 4), S. 29.
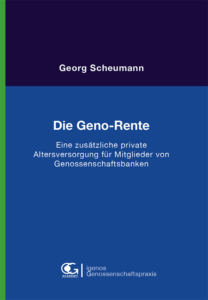
Neueste Kommentare